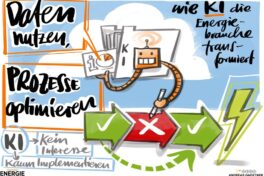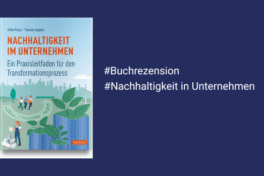Text: Dr. Robert Gerlach
Wie die Boden Messbarkeit regenerativer Landwirtschaft zum Gamechanger für Lebensmittelkonzerne wird
Die globale Landwirtschaft steht unter Druck wie nie zuvor. Dürren, Starkregen, Erosion, steigende Preise für Betriebsmittel wie Dünger und Pestizide – all das sind Symptome einer sich zuspitzenden Systemkrise. Sie betrifft nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern bedroht zunehmend auch die Stabilität und Zukunftsfähigkeit der gesamten Lebensmittelindustrie. Im Zentrum dieser Krise steht ein oft übersehener Akteur: Unser Boden.
Das Fundament unseres Ernährungssystems bröckelt
Über 95 % aller Lebensmittel stammen direkt oder indirekt aus dem Boden. Doch weltweit nimmt die Bodengesundheit rapide ab. Erosion, Humusverlust, Verdichtung und der Rückgang biologischer Aktivität führen zu sinkenden Erträgen, höheren Anfälligkeiten gegenüber Extremwetter und steigenden Produktionsrisiken. Landwirtinnen und Landwirte verlieren Resilienz und wirtschaftliche Stabilität mit unmittelbaren Konsequenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Für Lebensmittelunternehmen bedeutet das konkret: Weniger stabile Lieferketten, geringere Produktverfügbarkeit und wachsende Volatilität in Beschaffung und Produktion. In einer Branche mit engen Margen, globalem Wettbewerb und wachsendem Nachhaltigkeitsdruck wirkt sich das zunehmend auf die Profitabilität aus. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren massiv verschärfen.
Die Lösung liegt buchstäblich unter unseren Füßen
Doch die Krise birgt auch eine enorme Chance. Denn der Boden ist nicht nur Teil des Problems, sondern vor allem Teil der Lösung. Regenerative Landwirtschaft bietet einen systemischen Ansatz, der die Bodengesundheit aktiv verbessert und damit Resilienz, Produktivität und Nachhaltigkeit langfristig sichert.
Im Zentrum stehen Prinzipien, die natürliche Bodenprozesse fördern: stabile Bodenaggregate, eine funktionierende Bodenstruktur und ein aktives Bodenleben. Praktisch umgesetzt wird dies etwa durch vielfältige Fruchtfolgen, Zwischenfrüchte, reduzierte Bodenbearbeitung oder den Einsatz organischer Düngung.
Die Effekte sind gut dokumentiert: Höhere Wasserspeicherfähigkeit, geringere Erosionsanfälligkeit, verbesserte Nährstoffkreisläufe, größere Biodiversität und eine stärkere Resilienz gegenüber klimatischen Extremereignissen. Zugleich wird CO₂ im Boden gebunden und langfristig gespeichert, ein Beitrag zum Klimaschutz, der sich messen lässt.

Der P&L-Effekt: Warum sich regenerative Landwirtschaft rechnet
In vielen Diskussionen wird regenerative Landwirtschaft auf ihre CO₂-Wirkung reduziert. Doch dieser Blick ist zu eng. Ihr strategisches Potenzial liegt vielmehr in ihrer Fähigkeit, das Geschäftsmodell der Lebensmittelindustrie zukunftsfähig zu machen.
Lieferketten, die auf gesunden Böden basieren, sind stabiler, produktiver und weniger volatil. Investitionen in regenerative Praktiken entlang der Lieferkette sichern nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern reduzieren auch langfristig Kosten und Risiken.
Ein Beispiel: Ein Betrieb, der durch Zwischenfrüchte und reduzierte Bodenbearbeitung die organische Substanz im Boden erhöht, benötigt weniger synthetischen Dünger. Das spart Betriebsmittel und reduziert die Abhängigkeit von globalen Preisschwankungen. Gleichzeitig steigt die Ertragssicherheit bei Wetterextremen.
Solche Effekte lassen sich zwar nicht immer direkt auf einer CO₂-Bilanz abbilden, sie wirken aber stark auf das operative Ergebnis. Für Unternehmen mit langfristiger Verantwortung gegenüber Investoren und Kunden sind dies entscheidende strategische Argumente.
Messbarkeit als Schlüssel zur Skalierung
Die Wirkung regenerativer Landwirtschaft lässt sich bereits heute messbar machen, insbesondere über Bodenkohlenstoff (SOC) und THG-Emissionen. Diese Indikatoren bilden eine wichtige Grundlage für Insetting-Programme und werden bereits von zahlreichen Lebensmittelunternehmen genutzt, um ihre Lieferketten aktiv in großem Umfang klimaresilienter und zukunftsfähiger zu gestalten.
Gleichzeitig bilden SOC und Emissionen nur einen Teil des Wirkungsprofils ab. Die tatsächliche Systemwirkung regenerativer Praktiken reicht deutlich weiter. Sie zeigt sich auch in der Förderung von Biodiversität, der Verbesserung der Wasserinfiltration, der Stabilisierung von Erträgen, der Reduktion im Einsatz von Betriebsmitteln und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Erosion und Extremwetter.
Diese Faktoren sind entscheidend für die operative Resilienz, das Risikomanagement und die langfristige Produktivität landwirtschaftlicher Lieferketten – und lassen sich mit wachsender methodischer Reife ebenfalls messbar machen.
Pilotprojekt Biodiversität: Klim x DKB
Ein aktuelles Projekt von uns, von Klim in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank (DKB) setzt genau hier an: Gemeinsam entwickeln wir Methoden, um Biodiversität in Agrarökosystemen messbar zu machen, nicht nur punktuell, sondern skalierbar und praktisch relevant für landwirtschaftliche Betriebe und ihre Abnehmer.
Ziel ist es, konkrete Indikatoren wie Artenvielfalt in Zwischenfruchtflächen, Blühstreifen oder Bodenfauna systematisch zu erfassen. Und zwar digital, kosteneffizient und nachvollziehbar. Die gewonnenen Daten sollen als Grundlage für Insetting-Programme dienen, mit denen Lebensmittelunternehmen Biodiversität aktiv fördern und gleichzeitig ihre eigene Risikostrategie stärken können.
Dieses Projekt steht exemplarisch für den Weg, den es nun großflächig braucht: Gezielte Investitionen in Messbarkeit, Wirkungstransparenz und Wissenschaftskooperationen, um regenerative Landwirtschaft noch breiter zu skalieren.

Auf dem Weg zur systemischen Transformation
Darüber hinaus macht das Projekt auf einen weiteren, noch breiteren Trend aufmerksam. Immer mehr Lebensmittelunternehmen, von Markenherstellern bis zum Lebensmitteleinzelhandel integrieren regenerative Landwirtschaft als strategisches Element in ihren Lieferketten. Sie investieren heute bereits in konkrete Programme, arbeiten mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen und setzen Insetting-Instrumente ein, um Klima- und Bodenwirkungen in großem Maßstab zu aktivieren.
Dabei wächst das Verständnis, dass die Wirkung regenerativer Maßnahmen weit über CO₂ hinausgeht. Zusätzliche Indikatoren wie Biodiversität, Wasserrückhaltevermögen, Erosionsresilienz und Ertragssicherheit rücken zunehmend in den Fokus, nicht als “weiche Faktoren”, sondern als entscheidende Hebel für die operative und wirtschaftliche Stabilität von Agrarlieferketten.
Die regenerative Transformation ist längst Realität und sie wird nun durch bessere Messbarkeit strukturell verankert.

Dr. Robert Gerlach
Dr. Robert Gerlach ist CEO und Gründer des Tech-Unternehmens Klim.